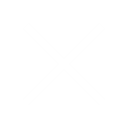Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich Walter A. Müller auf Anregung von Prof. Franz Studniczka daran begeben, die damals bekannten Zeugnisse der Völker des fruchtbaren Halbmonds, Ägyptens und Griechenlands zu analysieren auf das Vorkommen von »Nacktheit« (völlige Kleiderfreiheit) und »Entblößung« (einzelner Körperpartien, z. B. des Geschlechts). Die nachfolgenden Zitate (grüne Schrift) entstammen seinem Buch. [W.A. Müller, Nacktheit und Entblößung, Teubner 1906].
Ägypten (ab 1. Dynastie ca. 3032 v. C.)
»Die Denkmäler der ältesten Zeit zeigen bei den meisten Ägyptern als einzige Bekleidung eine Hüftschnur, an dem vorn ein längliches Futteral hängt, in dem das Glied geborgen wird.« Die Interpretation der Schleife, die auf den Bildern von der Hüftschnur vorn herunterhängt, als Penisfutteral, geht aus den Bildern allerdings nicht zwingend hervor — es könnten auch einfach herabhängende Schlaufen und Schnurenden sein: Ein extrem sparsamer Schurz.
 Altes Reich, 4. Dynastie, Pyramiden in Gizeh, Grab 75: Einige Männer tragen eine Hüftschnur, die vorn mit einer Schleife gebunden ist, andere tragen gar nichts, der Chef ist mit einem Schurz bekleidet. (1/16)
Altes Reich, 4. Dynastie, Pyramiden in Gizeh, Grab 75: Einige Männer tragen eine Hüftschnur, die vorn mit einer Schleife gebunden ist, andere tragen gar nichts, der Chef ist mit einem Schurz bekleidet. (1/16)
»Völlige Nacktheit ist selten. Beispiele dafür bieten eine Priesterstatue im Museum zu Gizeh und die Holzstatuette eines Mannes aus Deshasheh.«
 Altes Reich, 1. Dynastie, Plakette des Pharao Narmer. (4|16)
Altes Reich, 1. Dynastie, Plakette des Pharao Narmer. (4|16)
»Im mittleren Reich trägt man zu dem Zweck, um die Bewegung des Körpers so ungehindert als möglich zu machen, entweder einen Schurz, der nur das Gesäß und die Seiten bedeckt, so dass die Vorderseite offen bleibt, oder einen ganz kurzen… Oft wird aber während der Arbeit der Schurz ganz abgelegt und nur der Gurt getragen.«
Im Grab des Ti, eines hohen Beamten in der 5. Dynastie des ägyptischen Reiches, entstanden um 2400 v. Chr. umfangreiche Malereien. Sie stellen z. B. Szenen dar, die im Leben des Ti eine Rolle spielten, z. B. die Beaufsichtigung von Landarbeit, Entgegennahme und Verbuchung der Ernte usw. Einige der Landarbeiter tragen einen Schurz, der vorn offen ist und dem Geschlecht der Männer entsprechend Freiraum gibt. Andere trugen offensichtlich gar keinen Schurz.
 Altes Reich, 5. Dynastie, Grab des Ti, Detail. Drei Männer tragen die knappe Schurz-Variante mit offener Front, einer ist ganz nackt. (8/16)
Altes Reich, 5. Dynastie, Grab des Ti, Detail. Drei Männer tragen die knappe Schurz-Variante mit offener Front, einer ist ganz nackt. (8/16)
Es erscheint uns heute niedlich, dass dem Autor des Buches “Die Geschichte des alten Ägyptens” von 1887 diese Mode so frivol erschien, dass er für sein Buch eine bewusst falsche Konturenzeichnung anfertigte, in der entgegen der Original-Malerei alle Männer züchtig ihr Geschlecht mit einem Schurz bedeckten — aber vielleicht wäre seine Buchveröffentlichung andernfalls an der kaiserlichen Zensurbehörde gescheitert? Eine Konturenzeichnung desselben Motivs in dem Buch “Le tombeau de Ti” von 1953 stellte den Sachverhalt korrekt dar.
»Dem gleichen Zweck ungehinderter Beweglichkeit sehen wir auch die Tracht der Soldaten angepasst, nur dass diese mehr auf den Schutz der Schamteile zu achten haben. Sie tragen entweder die gleichen Schurzformen wie die Arbeiter oder verkürzen den vorderen Teil des gewöhnlichen Schurzes um die Hälfte; fast immer aber ist am Gürtel vorn ein oft beträchtlich großes Schutzblatt angebracht, das auch, wenn der Schurz zuweilen … fortgelassen wird, nie fehlt.«
»Es ist klar, dass bei dieser notdürftigen Bekleidung … eine stete Verhüllung der Geschlechtsteile nicht möglich war. Dass hierauf aber auch gar kein Wert gelegt wurde, … das beweist … auch die Tatsache, dass viele Arbeiter … auch die letzte Hülle ablegen und ganz nackt arbeiten.«
Frauen: »Die Kleidung der vornehmen Ägypterin besteht gewöhnlich aus einem dünnen, anliegenden, bis auf die Knöchel reichenden Hemd, das über den Schultern von zwei Tragbändern gehalten wird, sonst Busen, Schultern und Arme unverhüllt lässt. … Entblößungen kommen hier, wie bei Männern, bei lebhafter körperlicher Bewegung, Spiel und Arbeit vor.«
»Ausnahmen von dieser Bekleidung bringt die in Neuen Reich aufkommende Sitte der Enthüllung bei Leichenfeiern mit sich. Zum Zeichen der Trauer legen die Frauen die Mäntel ab und gürten das Hemd unterhalb der Brüste, ein auch von Herodot und Diodor, und zwar für beide Geschlechter überlieferter Brauch…«
Hier wird Entblößung also als Ehrerbietung zelebriert, ähnlich wie Priester*innen vieler antiker Religionen ihre Ehrerbietung den Göttern gegenüber durch Nacktheit ausdrückten.
Babylonien (ab ca. 1830 v. C.)
»Die altbabylonische Männertracht besteht wie die ägyptische der älteren Zeit aus Schurz und Mantel. Ersterer reicht bei den Vornehmen bis zur Mitte der Unterschenkel, wird jedoch von Kriegern zuweilen zur Erleichterung der Bewegung vorn verkürzt. Beim Volk reicht er oft nur bis zum Knie; die vorn abgerundeten oder die Vorderseite entblößenden ägyptischen Formen fehlen. Der Schurz ist das einzige Kleidungsstück bei lebhafter Bewegung.«
»Ausnahmen von der gewöhnlichen Bekleidung macht eine Reihe von Kultszenen… Eine weitere Ausnahme ist die Nacktheit der gefangenen und getöteten Feinde…«
 Ein gefallener Soldat liegt am Boden. Die Sitte, getötete Feinde nackt auf dem Schlachtfeld liegen zu lassen, war weit verbreitet, und hat sich bis in die griechische Zeit (Kampf um Troja) gehalten. (13|16)
Ein gefallener Soldat liegt am Boden. Die Sitte, getötete Feinde nackt auf dem Schlachtfeld liegen zu lassen, war weit verbreitet, und hat sich bis in die griechische Zeit (Kampf um Troja) gehalten. (13|16)
Gefangene oder getötete Feinde durch Nacktheit zu entehren hat Tradition bis in die Jetztzeit. Zuletzt bekannt geworden sind entsprechende Handlungen — heute als Verletzung des Völkerrechts und der Menschenrechte gebrandmarkt — von US-Soldaten bei Folterungen im Irak-Krieg.
Die Polarisierung, die Nacktheit und Entblößung bis in unsere Gegenwart auslösen, hat ihre Wurzeln also in den Jahrtausende alten Traditionen, durch Nacktheit Ehrerbietung auszudrücken (Totenehrung in Ägypten, Götterehrung durch PriesterInnen) oder aber Entehrung und Entrechtung (bei Gefangenen und gefallenen Feinden).
»Die Frau tritt in der gesamten vorderasiatischen Kunst entsprechend ihrer Stellung im Leben sehr zurück; Szenen aus dem Innern des Hauses fehlen fast ganz. Ihre Tracht wird gebildet aus einem Rock und einem schalartigen Tuch an Stelle des Hemdes, das aber im Gegensatz zu Ägypten den ganzen Oberkörper bedeckt.«
Assyrien (ab ca. 1800 v. C.)
»Die Tracht des Mannes, besonders des Kriegers … bildet ein bis zu den Knien reichendes, gegürtetes Hemd mit kurzen Ärmeln. Dazu tritt vielfach eine schützende Verhüllung der Beine durch hohe Stiefel und Strümpfe. … Wie in Ägypten tragen die Schiffer nur einen Gürtel oder sind ganz nackt… Die Frau erscheint in den seltenen Darstellungen ganz verhüllt.«
Syrien (ab ca. 1200 v. C.), verschiedene Völker
»So zeigt uns Syrien das Maximum an Verhüllung im Orient, eine Erscheinung, die umso auffallender ist, als hier klimatische Gründe durchaus nicht überall in Betracht kommen…«
_______
Alle Bilder: wikimedia.org, Lizenz: Creative Commons