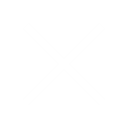In Griechenland lässt sich die Zeit des Trojanischen Krieges etwa um 1200 v. C. datieren, über den Homer dann etwa um 800 v. C. seine berühmten Dichtungen »Ilias« und »Odyssee« schrieb. Die Szene des schiffbrüchigen Odysseus, der 20 Tage lang im Wasser trieb und alle Kleider verloren hatte, bevor er sich auf eine Insel retten konnte, enthält die Worte:
»Also sprach er und kroch aus dem Dickicht, der edle Odysseus,
brach mit der starken Faust sich aus dem dichten Gebüsche
einen laubigen Zweig, des Mannes Blöße zu decken.«
Und an das anwesende Mädchen Nausikaa richtete er die Bitte:
»Zeige mich hin zur Stadt und gieb mir ein Stück zur Bedeckung,
etwa ein Wickeltuch.« [Homer, Odyssee, 6. Gesang, dt. J.H. Voß]
 Odysseus tritt mit einem belaubten Zweig vor seiner Blöße dem Mädchen Nausikaa entgegen und bittet um Hilfe. (1|8)
Odysseus tritt mit einem belaubten Zweig vor seiner Blöße dem Mädchen Nausikaa entgegen und bittet um Hilfe. (1|8)
Zur Zeit des Trojanischen Kriegs war es also längst unschicklich, sich nackt Mitmenschen des anderen Geschlechts zu zeigen, und diese Tendenz hat sich in der griechischen Klassik weiter verstärkt. Die bekannte Praxis, Gymnastik und Sport nackt auszuüben, war auf Männer beschränkt (und auf männliche Zuschauer bei den Wettkämpfen).
Zur Zeit des Trojanischen Kriegs war es also längst unschicklich, sich nackt Mitmenschen des anderen Geschlechts zu zeigen, und diese Tendenz hat sich in der griechischen Klassik weiter verstärkt. Die bekannte Praxis, Gymnastik und Sport nackt auszuüben, war (ein paar hundert Jahre später) auf Männer beschränkt (und auf männliche Zuschauer bei den Wettkämpfen).
 Griechische Ringer, gemeinfrei (2|8), Quelle: Walter’s Art Museum
Griechische Ringer, gemeinfrei (2|8), Quelle: Walter’s Art Museum
Von dem Dichter Aristophanes (ca. 440–380 v. C.) ist zu erfahren, dass sehr darauf geachtet wurde, die gemeinsame Nacktheit unter Männern beim Sport in sittsamem Rahmen zu halten: »Auf dem Turnplatz dann, wenn die Knaben zu ruhn in den Sand hinsaßen, so mussten sie die Beine ausstrecken, um schamhaft nichts die draußen erblicken zu lassen. Und standen sie auf, so verwischten sie gleich im Sande die Spur, zu verhindern, dass Liebenden der Natur Abbild unreine Begierden erregte. Dann salbte da auch kein Knabe sich je über den Nabel herunter. Es umblühte darum ein gekräuselter Flaum die Scham wie ein reifender Pfirsich.« [Duerr, Nacktheit und Scham, S. 17]
Neben der Nacktheit im Sport war auch der nackte Unterleib bei Kriegern verbreitet, was wahrscheinlich auf die Dorer zurückgeht und sich insbesondere in Sparta, aber auch in Korinth, lange gehalten hat — teilweise bis in die Tage Alexander des Großen (ca. 330 v. C.).
 Achilles verbindet Patroklos (5|8)
Achilles verbindet Patroklos (5|8)
Die Darstellung enthält Symboliken: 1. Das sichtbare Geschlecht des Patroklos ist ein Hinweis darauf, dass das Schwert Hektors ihn in der nachfolgenden Schlacht genau an dieser Stelle treffen und er durch Hektors Schwert sterben wird. 2. Der Pfeil neben Patroklos symbolisiert die Ankündigung, dass Achilles von einem durch Apoll gelenkten Pfeil in die Ferse getroffen und daran sterben wird. 3. Die Sichtbarkeit der Zähne des Patroklos, die seine Schmerzen andeuten. Und unerklärte Merkwürdigkeiten: Patroklos, der gerade aus der Schlacht kommt, ist ohne Helm, und die Schulterklappen des Panzers sind geöffnet, Achilleus dagegen mit Helm und Rüstung, obwohl er an der Schlacht gar nicht teilgenommen hat.
 Griechische Soldaten in Rüstung (6|8)
Griechische Soldaten in Rüstung (6|8)
Bis in die Zeit des klassischen Griechenland war man offensichtlich wenig zimperlich, welche Körperregionen denn nun von Kleidung bedeckt werden sollten. Für die Soldaten etwa kam es hauptsächlich darauf an, diejenigen Körperteile mit einer bronzenen Rüstung zu schützen, die im Kampf besonders gefährdet waren: Kopf, Oberkörper und die Schienbeine. Der Unterleib blieb — wie auf dem ⬈ Bronzekrater von ⬈ Vix dargestellt — oftmals ungeschützt und nackt — mit dem Vorteil, sich möglichst ungehindert bewegen zu können und daraus vielleicht die entscheidende Überlegenheit gegenüber einem Gegner zu gewinnen.
»Nachklänge der vorhergehenden Periode und den Übergang zum eigentlichen Griechentum zeigt uns Homer. Beim Manne lebt noch von der mykenisch-orientalischen Kultur die Tracht, Schurz und Mantel, das Schamgefühl und die Sitte der Entkleidung gefallener Feinde nach. Die Frau hingegen verhüllt jetzt durchgehends den Busen.«
»Die geometrische Kunst ihrerseits wirkt zur Zeit des griechischen Archaismus dort nach, wo sie hauptsächlich geherrscht hat: Im Mutterland. Hier ist die unbekleidete Gestalt, die zur Verkörperung von Jünglingen und Männern, Sterblichen und Göttern dient, der vorherrschende Typus geworden. Sie wird bald zum Idealbild des Menschen erhoben…«
»Dieses gesamte Bild ändert sich umso mehr, je weiter wir vom Festland nach Osten schreiten… Im griechischen Osten lebt … die orientalisch-mykenische Scheu vor Entblößung fort.«
Zitate aus W.A. Meyer, Nacktheit und Entblößung, Teubner 1906
Die Auswertung der Quellen zeigt also, dass die Periode der Menschheit, in der alltägliche Nacktheit praktiziert wurde, in den Völkern, über die eine historische Dokumentation existiert, mit der Epoche des Alten Reichs Ägyptens zu Ende ging. Alle späteren Formen gemeinschaftlicher Nacktheit betrafen nur noch Gruppen (Sportler, Badende, Krieger,…) oder besondere Gelegenheiten (Feste, Prozessionen,…) innerhalb der Gesellschaften, das gilt für Griechenland, das Römerreich, das Mittelalter und die Neuzeit. Ausnahmen sind gesichert für indigene Völker (Amerika, Afrika, Südsee u.a.m.), während wir über viele andere Kulturen (Indien, China, Azteken, Inka,…) nur Bruchstücke aus der Geschichte kennen.