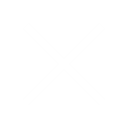Nacktheit wurde auch im alten Rom bereits als strafverschärfende Maßnahme gegenüber Straftätern eingesetzt. Neben nackten Kreuzigungen ist auch der Tod des heiligen Laurentius überliefert: Er wurde am 10. August 258 nackt auf ein Gerüst gelegt und bei lebendigem Leibe über dem Feuer zu Tode gegrillt. Er hatte sich geweigert, dem römischen Kaiser Valerian den Schatz der Kirche auszuliefern, und diesen stattdessen an die Armen und Kranken verteilt — so wie es ihm der zuvor hingerichtete Papst Sixtus aufgetragen hatte.
 St. Laurentius nackt über dem offenen Feuer (1|8)
St. Laurentius nackt über dem offenen Feuer (1|8)
Aus dem Römischen Reich sind uns die — zu Beginn nach Geschlechtern getrennten — Badehäuser überliefert, in denen aber nur zum Teil nackte Badekultur praktiziert wurde. Mit dem Untergang des Römischen Reiches verschwand auch die Badekultur, und erst ein halbes Jahrtausend später brachten die heimkehrenden Kreuzritter die Praxis der Badehäuser aus dem östlichen Mittelmeerraum wieder nach Mitteleuropa zurück. Mit den Badehäusern entwickelte sich der neue Berufsstand der ⬈ »Bader«.
 Im mittelalterlichen Badehaus ist viel Betrieb. Es wird nicht nur gebadet, gespeist und getrunken sondern auch berührt — typisch eher für die Spätzeit der Badehäuser. Public Domain. (3|8)
Im mittelalterlichen Badehaus ist viel Betrieb. Es wird nicht nur gebadet, gespeist und getrunken sondern auch berührt — typisch eher für die Spätzeit der Badehäuser. Public Domain. (3|8)
Wenn heute ein Gast nach einer etwas längeren Anreise eintrifft, dann bietet man ihm an, sich die Hände zu waschen, etwas zu trinken zu reichen oder ggf. zu essen. Dies hat eine uralte Tradition. Zu Zeiten, als die Wege noch unbefestigt und staubig waren, als man zu Fuß oder zu Pferd reiste, bestenfalls in einer Kutsche, da dauerten Reisen oft lange, Tage oder Wochen, und man kam immer staubig und verschwitzt am Ziel an.
Von der Antike bis zur Neuzeit bot man daher dem eintreffenden Gast zu allererst — noch vor einer Stärkung — ein Bad an, was der Reisende in aller Regel auch dankend gern annahm. Der Kessel mit heißem Wasser stand sowieso auf dem Herd, es wurde in den Badezuber gegossen, mit kaltem Wasser temperiert, vielleicht sogar noch mit ein paar Duftnoten aufgebessert.
Sodann konnte sich der Gast entkleiden und in die wohltuenden Fluten steigen. Nacktscham beim Bade gab es nicht. Man war seit Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden daran gewöhnt, in Gegenwart anderer Menschen zu baden — besaßen doch die meisten Häuser nur einen kombinierten Wohn-Schlafraum mit Kochecke, und natürlich fand auch das Bad in diesem (einzigen) Raume statt.
 Bad im Holzzuber — Man wird bekränzt, Kräuter und Blumen aromatisieren das Badewasser, ein Kelch mit Getränk wird gereicht, bei Bedarf warmes Wasser nachgegossen — Verwöhnung als Willkommensgruß. (4|8)
Bad im Holzzuber — Man wird bekränzt, Kräuter und Blumen aromatisieren das Badewasser, ein Kelch mit Getränk wird gereicht, bei Bedarf warmes Wasser nachgegossen — Verwöhnung als Willkommensgruß. (4|8)
 Pranger in Wang. Hier wurden Straftäter »angeprangert«. Die Bevölkerung hatte dann ein oder zwei Stunden lang die Möglichkeit, sie zu schmähen und zu verspotten. (5|8)
Pranger in Wang. Hier wurden Straftäter »angeprangert«. Die Bevölkerung hatte dann ein oder zwei Stunden lang die Möglichkeit, sie zu schmähen und zu verspotten. (5|8)
Von »nackt« wurde im Mittelalter auch schon dann gesprochen, wenn die Menschen nur noch ein Hemd oder etwa eine Schambinde trugen. Das gilt auch für die gängigen Strafen, »nackt an den Pranger gestellt« oder »nackt durch die Stadt getrieben« zu werden — auch hier verblieb den Bestraften meist noch ein (Unter-) Hemd am Leib. Wir kennen heute noch die Steigerungen »nackt und bloß« (die insbesondere die Blöße der Genitalien einschließt) oder »splitternackt« (was das Fehlen jeglicher Bedeckung meint).
Eines der finstersten Kapitel in der Geschichte Europas ist die Zeit der Hexenverfolgung. »Immer fester wurzelte der Glaube an Bündnisse mit dem Bösen, aber erst die Inquisitoren des 13. Jahrh. wussten diesen den armen Hexen zu vermählen und erbauten eine förmliche Teufelslehre. Den ersten Hexen, wie es heißt 1230–1240 in Trier, wurde vorgeworfen, sich in Kröten verwandelt zu haben…«, weiß die Brockhaus-Enzyklopädie. Ab 1275 ist gesichert überliefert, dass die Bestrafung der Hexen meist durch Verbrennung erfolgte. Vielfach wurden dazu die »Hexen« nackt auf den Scheiterhaufen gefesselt.
 Hexenverbrennungen erfolgten oftmals nackt (6|8)
Hexenverbrennungen erfolgten oftmals nackt (6|8)
Über die Verhöre weiß die Brockhaus-Enzyklopädie zu berichten, dass zunächst den Verdächtigen nur vorab mit drastischen Worten ausgemalt wurde, welche Schmerzen sie zu erleiden haben würden, wenn sie nicht gestehen (Verbalterrition). Falls das nichts fruchtete, folgte die Realterrition: »Bei der Realterrition wurde der/die Verdächtige entkleidet, ihm auch die Werkzeuge wirklich angelegt, doch kein Schmerz damit zugefügt.« Erst wenn auch diese Demonstration nicht zu dem gewünschten Ziel eines Geständnisses führte, »wurde die Folter des Morgens sehr früh in einem entlegenen Gemach vorgenommen und eine Stunde lang fortgesetzt…«
 Entkleidung einer »Hexe« während des Verhörs durch Inquisitoren (7|8)
Entkleidung einer »Hexe« während des Verhörs durch Inquisitoren (7|8)
Thomasius und Voltaire waren prominente Wortführer, die die Unzuverlässigkeit erpresster Aussagen und die daraus folgende Nutzlosigkeit von Folter anprangerten. Die Folter wurde in Frankreich mit der Revolution 1789 abgeschafft, in Preußen schon 1740 durch Friedrich den Großen, in Hannover erst 1822, in Coburg-Gotha 1828.