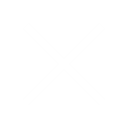Yawalapiti in Brasilien
Der erste Kontakt der Yawalapiti mit Nichtindigenen fand im Jahr 1887 statt, als der deutsche Ethnologe Karl von den Steinen bei einer Expedition auf die Bevölkerungsgruppe traf. In seinen Büchern schildert er den kleinen Stamm als sehr arm. Durch Kämpfe mit anderen Stämmen und einen Masern-Ausbruch gerieten die Yawalapiti Mitte des 20. Jahrhunderts in eine existentielle Krise, haben sich aber in mehreren neuen Dörfern inzwischen zu einer Stammesgesellschaft von ca. 240 Personen erholt.
Der Stamm der Yawalapiti lebt bis heute am Xingu, einem Nebenfluss des Amazonas. Einmal im Jahr feiern sie ein Fest zu Ehren der Verstorbenen, zu dessen Vorbereitung die Jungen bis 10 Jahren mit Pfeil und Bogen Fische erlegen. Ihre Kleidung ist bis heute eine Lendenschnur, die allerdings seitlich und hinten gürtelartig verbreitert ist und an deren Vorderseite ein sehr spärlicher, eher symbolischer Schurz aus ein paar Textilfasern befestigt ist.
Der Kult der Yawalapiti ist nur eine von 16 verschiedenen Stammeskulturen der Xingu-Indianer. Die Brasilianer Orlando Villas Bôas und sein Bruder betrieben hier von 1946 bis 1973 einen Verwaltungs- und Handelsposten und trugen wesentlich dazu bei, dass im Jahr 1961 am Alto Xingu der Parque Indígena do Xingu eingerichtet wurde, um den verbliebenen ethnischen Minderheiten einen Schutzraum zu bieten.
 2/24 Yawalapiti beim Fest. Autor: Innercircle. Creative Commons-Lizenz
2/24 Yawalapiti beim Fest. Autor: Innercircle. Creative Commons-Lizenz
Langjähriger Anführer war Aritana Yawalapiti (1949–2020), der als Vertreter aller Xingu-Indianer und Umweltaktivist für die Rechte der Indigenen in Brasilien kämpfte. Er starb mit 71 Jahren an COVID-19.
⤷ Weitere Informationen zu Yawalapiti auf der Site brasilienportal.ch
⤷ Weitere Informationen zu Yawalapiti auf der Site socioambiental.org (Sprache: EN)
Anna Terra Yawalapiti
Die Organisation ⤷ Levante Popular da Juventude wurde mit dem Fotopreis »Kampf gegen die Rückschläge« ausgezeichnet: »Bestehen und Widerstand gegen den Entzug von Rechten«. Der Wettbewerb wird vom Brasilien-Fonds gefördert, um den Einsatz der Fotografie im Kampf für die Verteidigung der Rechte zu unterstützen. Das Bild »The Silence of the Earth« des Fotografen Matheus Alves erhielt in einer Abstimmung die meisten Nennungen. Es zeigt Anna Terra Yawalapiti, indigene Anführerin des Xingu, in traditioneller Körperbemalung und Schmuck-Kleidung während einer Demonstration auf dem Acampamento Terra Livre in Brasília (DF), bei der sie ein Ende der Polizeirepression einfordert.
Yawalapiti-Kinder im Plastik-Zeitalter
Die naturbezogene Lebensweise indigener Völker, z. B. der Yawalipiti im Xingu-Gebiet, galt den Naturisten lange Zeit als Vorbild für ihre eigene Einstellung. Inzwischen hat sich diese Vorbild-Funktion jedoch verloren, denn die meisten dieser Völker hat längst die Zivilisation erreicht: Die Yawalipiti-Kinder im Bild rechts tragen neben anderen, industriell verarbeiteten und verpackten Lebensmitteln Wasser in Einweg-Plastikflaschen in ihr Dorf. Ob die Flaschen über den Xingu Fluss im Amazonas landen und folglich anschließend im Meer? Oder sind die Yawalapiti-Dörfer an ein Recycling-System angeschlossen?
Yanomami in Brasilien/ Venezuela
Das indigene Volk der Yanomami (Ianomâmi, Yanomamõ, Yanomama, Yanoama, Xirianá) ist eine Gesellschaft von Jägern und Bauern im tropischen Regenwald von Amazonien beidseits der brasilianisch-venezolanischen Grenze, im Gebiet des Zusammenflusses von Rio Orinoco und Amazonas sowie den Nebenflüssen rechts des Rio Branco und links des Rio Negro. Das Volk besteht aus einer linguistischen und kulturellen Vereinigung von mindestens vier Untergruppen, die aus derselben Sprachfamilie stammen, dem Yanomae, Yanõmami, Sanima und Ninam. Die Gesamtbevölkerung der Yanomami in Brasilien und Venezuela wird heute auf rund 41.500 Personen geschätzt. Einige Yanomami haben berichtet, dass sie unkontaktierte Yanomami in ihrem Gebiet getroffen haben (also Gruppen, die sich bewusst und bis heute erfolgreich dem Kontakt zu Weißen entziehen).
Für die Yanomami ist “urihi”, der Erdenwald, nicht nur eine einfache Oberfläche, bestimmt zu ihrer wirtschaftlichen Nutzung, sondern ein lebendiges Wesen, in dem ein Austausch zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Wesen stattfindet. Er ist heute bedroht durch die blinde Profitsucht der Weißen, wie Häuptling Davi Kopenawa sagt: “Der Erdenwald kann nur durch die Zerstörung der Weißen sterben. Dann werden die Bäche verschwinden, die Erde wird kalt werden, die Bäume vertrocknen und die Steine der Gebirge werden sich vor Hitze spalten.”
Die frühesten Kontakte von Yanomami-Mitgliedern zu Weißen fanden gegen Ende des 19. Jahrhunderts statt. Etwa zwischen 1910 und 1940 waren einige Stämme des öfteren Ziele von internationalen Besuchergruppen. Der Bau der Straße “Perimetral Norte” in den 1970er Jahren löste nach der Entdeckung diverser Bodenschätze in dem Gebiet eine Invasion von Goldsuchern aus, die die Lebensgrundlagen der Yanomami bis heute gefährden, obwohl ihr Lebensraum “Terra Indígena Yanomami”, der in Brasilien 96.650 km² Regenwaldes umfasst, 1992 per Präsidenten-Dekret geschützt wurde.
Bei den Yanomami Männern genügte als Kleidung eine einfache Lendenschnur ohne Schurz. Allerdings wurde der Penis mit einer Schlaufe um die Vorhaut an die Lendenschnur hochgebunden. Nur in diesem Zustand fühlten sich die Männer korrekt »bekleidet« — andernfalls fühlten sie sich zutiefst beschämt, wenn sie mit frei hängendem Penis gesehen wurden.
 6/24 Yanomami-Männer. Quelle: Usenet
6/24 Yanomami-Männer. Quelle: Usenet
Das Bild ist historisch. Da die Yanomami seit vielen Jahrzehnten von Missionaren, Landräubern und Umweltzerstörern terrorisiert und ausgebeutet werden, tragen sie heute oftmals Shorts bzw. Röcke.
⤷ Weitere Informationen zu Yanomami auf der Site brasilienportal.ch
⤷ Weitere Informationen zu Yanomami auf der Site survivalinternational.de
⤷ Weitere Informationen zu Yanomami auf der Site socioambiental.org (Sprache: EN)
Indigene in der Südsee: Tanna (Vanuatu)
In der Südsee lebt auf der Insel Tanna (zu Vanuatu, Neue Hebriden) heute noch ein Volk seinen traditionellen Kult, in dem das Leben der Menschen in Einheit und Harmonie mit der Natur eine zentrale Rolle spielt. Hier tragen die Männer die »Namba«, eine aus Bast geflochtene Penishülle. Das Volumen dieses Konstrukts ist aufgrund der vielen gewickelten Bastschichten bei einigen Exemplaren recht groß, so dass auch hier europäische Entdecker die gewollte Betonung des Penis als Hintergrund vermuteten, so wie es im ausgehenden Mittelalter in Europa mit der Einarbeitung einer vorspringenden Peniskapsel in die Hosen gehalten wurde. Aber das ist irrig! Die Menschen tragen ihre Bedeckung aufgrund von Genitalscham.
Die zum Büschel gebundenen, langen Bastfäden hängen bis zu den Knien zwischen den Beinen hinab und bedecken so den Hodensack. Gehalten wird das Ganze nur von einer Lendenschnur — eine erstaunlich stabil sitzende Konstruktion, die allerdings nicht ganz leicht anzuziehen ist, wie uns ein 14-jähriger Franzose berichtet, der die Namba ausprobieren und einige Tage mit dem Stamm zusammen leben durfte. Er musste sich beim Anziehen helfen lassen (Bild 15).
Der Grund für die Männer auf Tanna, die Namba zu tragen, ist eine Genitalscham, die ja in fast allen Kulturen der Erde vorhanden ist. Hier scheint sie eine besondere Ausprägung zu haben: Nach dem gemeinsamen, nackten Bad im Fluss hält sich der Einheimische bei der Dusche im Wasserfall krampfhaft die Hände vors Geschlecht, obwohl die Gruppe im Wald nur aus Männern besteht und der Wasserfall ohnehin schon ein wirksames Unschärfe-Filter vorschaltet.
 16/24 Einheimische junge Männer
16/24 Einheimische junge Männer
 18/24 Ein Internationales Flöten-Ensemble
18/24 Ein Internationales Flöten-Ensemble
Die Jungs aus Frankreich besuchten die frisch beschnittenen Jungs des Stammes im Baumhaus, wo sie so lange ausharren, bis die Wunden der Beschneidung verheilt sind (Bild 20–21). Mädchen und Frauen tragen einen Bastrock.